Filmstadt Hamburg
Hamburger Filmbüro e.V. (1979-1994)
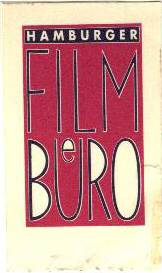
Entstehung
Beim "Filmfest der Filmemacher 1979" wurden nicht nur Filme gezeigt, sondern auch Politik gemacht.
Am Ende der einwöchigen Veranstaltung gaben die aus der ganzen Bundesrepublik angereisten Filmemacher/-innen die "Hamburger Erklärung" ab. Diese Erklärung beinhaltete das Versprechen nebeneinander und gemeinsam Genre übergreifend Filme und Videos zu produzieren und die "unabhängige Filmkultur im Hamburger Raum fördern" (Satzung des Vereins).
Die teilnehmenden Filmschaffenden vertraten die Meinung, dass der Deutsche Film der 80er Jahre nicht mehr von Gremien, Anstalten und Interessengruppen fremdbestimmt werden sollte.
Einige dieser Filmschaffenden schlossen sich zum Hamburger Filmbüro e.V. zusammen. Mit der finanziellen Unterstützung in Höhe von drei Millionen Mark von der Stadt Hamburg sollte der Betrieb des Filmhauses und die kulturelle Filmförderung finanziert werden. Das besondere daran war, dass die Filmemacher/-innen die Förderungsmittel selbst verwalten sollten.
Selbstverwaltung
Zwischen der Hamburger Kulturbehörde und dem Verein Hamburger Filmbüro e.V. gab es eine "Vereinbarung über die Richtlinien für die Projektförderung". Die Fördergelder wurden demnach in zwei Schwerpunktbereichen im Verhältnis 30 zu 70 verteilt.
70% der drei Millionen Mark gingen an Lang(-spiel)Filme, die im Kino laufen sollten. Einbezogen waren hier ausdrücklich auch Dokumentar- und Nachwuchsfilme. Die Obergrenze der Bezuschussung eines Filmes lag zuletzt bei 300.000 Mark.30% der Fördergelder gingen an "Filme, die durch die Raster gefallen sind", das waren z.B. Kurzfilme und/oder innovative Projekte aus allen filmischen und elektronischen Produktionsverfahren. Hier lag die Höchstfördersumme bei 80.000 Mark.Die Selbstverwaltung bestand darin, dass der gesamte Förderungsablauf über das Filmbüro ging und die Gremien vom Verein Hamburger Filmbüro gewählt wurden.
Jährlich wurden vier Gremien gewählt, die aus je drei Personen bestanden. Für jeden Schwerpunkt gab es zwei Gremien, eines bestand aus Filmemachern (Filmprofis) und eines aus Journalisten, Musikern, Malern, Wissenschaftlern usw. (Filmlaien).
Jährlich wurden etwa 400 Filme eingereicht, wobei nur 20 bis 30 Projekte gefördert werden konnten.
Wer bekam Gelder?
Außerhalb Hamburgs waren viele der Meinung, das Hamburger Selbstverwaltungsmodell sei ein Selbstbedienungsmodell.
Die Statistik sagt aber, dass die Geförderten überwiegend nicht aus Hamburg kamen. Bedingungen gab es aber trotzdem. Der Film musste in Hamburg gedreht werden oder einen kulturellen Bezug zu Hamburg haben. Über den Hamburg-Bezug entschied das Gremium.